Der deutsche Neoliberalismus kämpft mit seinen Widersprüchen. Gegenkräfte für die Erzwingung eines Strategiewechsels der deutschen Bourgeoisie sind nicht in Sicht
Von Beate LandefeldDie BRD-Politik versucht auf Biegen und Brechen, eine bestimmte Spur nicht zu verlassen, die Spur der »Stabilitätspolitik«. Ihr gilt die Bekämpfung der Inflation als wichtigste Aufgabe staatlicher Wirtschaftssteuerung. Sie kann als die für die Bundesrepublik typische Wirtschaftspolitik angesehen werden. Sie war fester Bestandteil der mehr liberalen als sozialen Marktwirtschaft Ludwig Erhards (siehe jW-Thema vom 17.12.2008) und gewann schon nach der Krise 1974/75 unter dem damaligen Bundeskanzler Helmut Schmidt (SPD) wieder die Oberhand. Nur nach der Rezession 1966/67 bis in die erste Hälfte der 70er Jahre gab es ein kurzes Zwischenspiel einer eher keynesianisch geprägten Wirtschaftpolitik, mit der dann folgenden »Reformära« unter Willy Brandt (SPD).
Die »Stabilitätspolitik« hat Preissteigerungen und Staatsverschuldung zu keiner Zeit verhindert. Unter dem Vorwand der Inflationsbekämpfung zielt sie auf Kostensenkung zu Lasten der arbeitenden Menschen, auf niedrige Löhne, niedrige Sozialausgaben und den »schlanken Staat«. Sie dient dazu, die Wettbewerbsfähigkeit der deutschen Konzerne auf dem Weltmarkt zu stärken und nimmt dafür die Verkümmerung des Binnenmarkts, hohe Arbeitslosigkeit sowie die Vernachlässigung und den Verfall gesellschaftlich nützlicher Bereiche der öffentlichen Infrastruktur in Kauf. Einen »schlanken Staat« brachte die »Stabilitätspolitik« nicht, wohl aber Umverteilung von unten nach oben, zugunsten von Profiten und Vermögenseinkommen.
Nachdem, wie NRW-Ministerpräsident Jürgen Rüttgers (CDU) treffend formuliert hat, die »neoliberale Blase geplatzt« ist, sprechen einige rechte und neoliberale Politiker und Verbandsfunktionäre wie Michael Hüther, Chefideologe des Instituts der deutschen Wirtschaft, von einer »keynesianischen Situation«, in der man pragmatisch mit »keynesianischen Maßnahmen« – so der Begriff von Bundesinnenminister Wolfgang Schäuble (CDU) – hantieren müsse. Das Konjunkturpaket I schien vielen Politikern und Konzernchefs zu klein, und sie forderten daher einen Nachschlag. Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) und ihr Finanzminister Peer Steinbrück (SPD) mußten nachgeben.
Noch während der Diskussion um das Konjunkturpaket II begann eine massive Kampagne für die Aufnahme einer »Schuldenbremse« in das Grundgesetz. Man will dadurch Begehrlichkeiten vorbeugen, die die Diskussion über Konjunkturprogramme in der Bevölkerung wecken könnte. Beim »Bankenschirm« fragte niemand nach der Schuldenbremse. Es stellt sich die Frage, ob der neoliberale Kurs auch bei längerer Dauer der Krise durchgehalten werden kann oder ob die Krise der herrschenden Klasse einen Strategiewechsel aufnötigen wird.
35 Jahre »Stabilitätspolitik«
Vor dem Versuche einer Antwort ist es nützlich, sich anzuschauen, was Autoren des Instituts für Marxistische Studien und Forschungen (IMSF) kurz nach der letzten größeren Krise der Weltwirtschaft in den Jahren 1974/75 zur damaligen »stabilitätspolitischen« Ausrichtung Helmut Schmidts geschrieben haben: »Dieser Kurs hat nach innen einen sozialreaktionären, nach außen einen expansiven Charakter. Er kann im wesentlichen nur unter zwei Bedingungen durchgehalten werden: erstens, wenn und solange die inneren sozialökonomischen und politischen Kräfteverhältnisse stabil bleiben und kein Umschalten auf einen nachfrageorientierten Expansionskurs, der höhere Inflationsraten in Kauf nehmen müßte, erzwingen und ein relativ niedriges Lohnniveau erhalten werden kann; zweitens, solange die Handelspartner die Gläubigerposition der BRD und ihre expansive Handelspolitik hinnehmen oder sie aus Eigeninteresse hinzunehmen gezwungen sind und nicht mit protektionistischen Maßnahmen reagieren. Gleichwohl kann diese Politik selbst unter diesen Bedingungen die negativen Krisenauswirkungen nicht beseitigen. Ihr für das Monopolkapital positiver Effekt besteht aber darin, daß die Größenordnung und Internationalisierung der westdeutschen Konzerne und Finanzgruppen beschleunigt vorangetrieben werden kann und daß sich auf diesem Wege die ›Modernisierung‹ der westdeutschen Wirtschaft vollzieht. Dies realisiert sich in der privatmonopolistischen Entwicklungsvariante des SMK der BRD.«1Die beiden genannten Bedingungen für das Durchhalten der »Stabilitätspolitik«, das innere Kräfteverhältnis und die Interessenlage der Handelspartner müssen auch heute berücksichtigt werden, wenn gefragt wird: Ist der Neoliberalismus in der BRD gescheitert?
Mit den vom IMSF zitierten negativen Krisenauswirkungen ist vor allem die Massenarbeitslosigkeit gemeint, die trotz Konjunkturaufschwung nach der Krise 1974/75 geblieben ist, nach jeder Rezession weiter anstieg und dauerhaft die Löhne gedrückt hat. Ein relativ niedriges Lohnniveau konnte damit in der BRD erhalten werden. Bundesbank, Regierung und Konzerne sind auf diese Errungenschaft ihrer »Stabilitätspolitik« besonders stolz. Der Kampf um moderate Löhne sei lang und hart gewesen, das Ergebnis dürfe nicht verspielt werden, zitiert noch am 3. Februar 2009 das Handelsblatt einen Vertreter des Instituts der deutschen Wirtschaft.
Der sozialreaktionäre Kurs nach innen wurde seit 1974/75 in mehreren Schüben noch verstärkt: 1982 mit Kohls »geistig-moralischer Wende«, 1989 mit der konterrevolutionären Wende in der DDR und in den 90er Jahren mit dem Durchmarsch des Neoliberalismus, der politisch in der Agenda 2010 mündete. Wir haben es in der BRD mit einer inzwischen mehr als 35jährigen Rechts entwicklung zu tun, die zwar an manchen Punkten verzögert, aber nie wirkungsvoll umgekehrt werden konnte.
Die Organisationen der Arbeiterbewegung wurden geschwächt, zahlreiche früher erkämpfte Erfolge zurückgedreht. Mit dem Köder der Antiinflationspolitik gelang es zudem, großen Teilen der lohnabhängigen Mittelschichten die neoliberale »Modernisierung« schmackhaft zu machen. Symptomatisch hierfür war die Entwicklung der Grünen bis zur Agenda 2010.
Auf die Bindung möglichst großer Teile dieser Schichten an das bürgerliche Lager zielt die von Unternehmerverbänden, CDU/CSU und FDP trotz Krise forciert betriebene Steuersenkungspolitik für »Leistungsträger« als rechte Variante von Konjukturpolitik. Die Wahlen in Hessen und Meinungsumfragen zeigen, daß dies bisher Erfolg hat.
Daher lautet meine erste These: Die innenpolitischen Kräfteverhältnisse erzwingen zur Zeit keinen Strategiewechsel der deutschen Bourgeoisie vom Neoliberalismus zu einer stärker keynesianisch orientierten Politik. Daß sich dies im weiteren Verlauf ändert, dafür werden sicher alle von uns, mit den bescheidenen Kräften, die wir haben, wirken, indem wir die geplanten Aktionen von Gewerkschaften und außerparlamentarischen Bewegungen am 28. März, am 1. Mai und am 16. Mai unterstützen.
Exportpolitik unter Druck
Wie sieht es mit der zweiten Bedingung, mit den internationalen Kräfteverhältnissen aus? Auch sie haben sich seit Mitte der 70er Jahre grundlegend zum Nachteil der progressiven Kräfte verändert. Zusammenbruch des real existierenden Sozialismus in Europa und neoliberaler Umbau in praktisch allen reichen kapitalistischen Ländern seien hier nur als Stichpunkte genannt. Ökonomisch kam es auf internationaler Ebene durch Umverteilung, Senkung von Lohnkosten und den Einsatz neuer Technologien zu einer Erhöhung der Profitabilität des Kapitals, zu gesteigerter Kapitalanhäufung, zu einer »Restauration von Klassenmacht«, die der New Yorker Ökonom David Harvey als das Wesen des Neoliberalismus interpretiert hat.Normalerweise muß Produktivitätserhöhung bei dauerhaft stagnierender Lohnentwicklung zu einer über zyklische Krisen hinausgehenden, strukturellen Überakkumulation führen. Daß diese Schranke hinausgeschoben werden konnte und es in den letzten Jahrzehnten zu vier bis fünf Prozent hohen Wachstumsraten der Weltwirtschaft kam, ist hauptsächlich auf zwei Faktoren zurückzuführen: auf den durch Verschuldung finanzierten US-Konsum, der die Exportüberschüsse der BRD, Japans und Chinas indirekt absorbieren konnte, und auf die Öffnung und nachholende Industrialisierung vor allem der Volksrepublik China, die für Asien und andere Schwellen- und Rohstoffländer die Rolle eines Wachstumsmotors übernahm. Dabei wurde China zum Hauptgläubiger der USA.
Die deutsche Bourgeoisie konnte in dieser Phase ihren Spielraum durch die Einverleibung der früheren DDR und im Prozeß der EU-Bildung erweitern. Bei der Einführung des Euro machte sie den »Stabilitätspakt« und die »Unabhängigkeit« der Europäischen Zentralbank (EZB) zur Bedingung. Beides sind Hebel, um die »Stabilitätspolitik« für die gesamte Eurozone verbindlich zu erklären. Dies steigerte die Wettbewerbsfähigkeit der deutschen Konzerne und verhalf der BRD zu kontinuierlicher Exportweltmeisterschaft. Die deutsche Wirtschaftselite sieht sich als »Gewinner der Globalisierung«, und Konzernchefs wie Peter Löscher von Siemens und aktuell auch der neue Wirtschaftsminister Karl-Theodor zu Guttenberg verkünden zum Jahresanfang fast wortgleich mit Merkel den Willen, aus der gegenwärtigen Krise gestärkt hervorzugehen.
Ähnlich wie die Regierungs- und Konzernvertreter anderer vom Export abhängiger Länder engagieren sich die Bundeskanzlerin und die deutschen Konzernspitzen derzeit vehement gegen die »Gefahr des Protektionismus«. Eine entsprechende Warnung gab Merkel seit der Wahl Barack Obamas zum neuen US-Präsidenten mehrfach an die Medien. In Davos tat sie ihr Mißtrauen darüber kund, daß die USA Subventionen in ihre Automobilinustrie stecken.
Grundsätzlich ist zu sagen, daß bei solchen Warnungen immer nur der Protektionismus der anderen gemeint ist, nicht der eigene. In der internationalen Konkurrenz existierte auch in den vergangenen Jahrzehnten beides, Freihandel und Protektionismus. Beides dreht sich, wie der italienische Kommunist und Philosoph Antonio Gramsci formulierte, nur um verschiedene Versuche, die für die eigene Nationalökonomie wesentlichen Industrien auf eine für sie möglichst günstige Weise in den Weltmarkt einzugliedern. Auch die deutsche »Stabilitätspolitik« zielt auf nichts anderes – mal abgesehen von Bankenschirmen, Deutschland-Fonds, Hermes-Bürgschaften, Hilfen für Airbus-Käufer oder Abwrackprämien.
Der »stabilitätspolitische« Protektionismus scheint durch die gegenwärtige Krise allerdings an seine Grenzen zu stoßen. Mit diesem Kurs verwickelt sich die Bundesregierung in immer mehr Widersprüche, die im Verlauf der Krise offen zutage treten: Einerseits zeigt die Krise, daß steigende deutsche Exporte über die globalen Lieferbeziehungen nach wie vor von einem Wachstum des US-Binnenmarkts abhängig sind – andererseits erklärt die Bundesregierung die tiefere Ursache der Krise damit, daß »andere« über ihre Verhältnisse gelebt hätten, fordert also im Prinzip die US-Bürger zum Sparen auf. Einerseits werden die USA bei einer länger dauernden Depression als Lokomotive für hohe Raten von Weltwirtschaftswachstum vorerst ausfallen – andererseits will die Bundesregierung möglichst vermeiden, diesen Ausfall an Nachfrage durch eine Stärkung des Binnenmarkts der BRD und der EU zu kompensieren. Ihre Beteiligung an den weltweiten Konjunkturprogrammen hat mehr symbolische als ökonomische Bedeutung.
Einerseits braucht die Bundesregierung die Rückendeckung der EU, wenn sie bei der internationalen Koordinierung der Fiskal- und Wirtschaftspolitik und bei der Reregulierung der Finanzmärkte ein gewichtiges Wort mitreden will – andererseits trägt sie mit ihrer »Stabilitätspolitik« zur Desintegration und Schwächung der EU bei, indem sie sich z. B. weigert, dem Abdriften einiger EU-Südländer in Richtung eines Staatsbankrotts mit kollektiven Hilfsmaßnahmen der Länder der Eurozone rechtzeitig entgegenzuwirken. Einerseits hat Merkel die Forderung nach einer »europäischen Wirtschaftsregierung«, vorgebracht von Frankreichs Präsident Nicolas Sarkozy, brüsk weggebürstet, um die Alleinherrschaft der EZB nicht aufzuweichen – auf der anderen Seite tritt sie für einen »Weltwirtschaftsrat« ein, der eine »globale soziale Marktwirtschaft« befördern soll; der Staatssekretär im Bundeswirtschaftsministerium Bernd Pfaffenbach plädiert gar für weltweit verbindliche Regeln zum Schuldenabbau nach dem Vorbild des europäischen Stabilitätspakts.
Bürgerliche Kritiker sehen im sturen Kurs der Bundesregierung eine Verweigerung der in der Krise besonders nötigen engen internationalen Kooperation. Als Kronzeuge sei hier ein glühender Verfechter der Globalisierung zitiert, der Chefvolkswirt der Deutschen Bank, Norbert Walter: »Man stelle sich vor, die Berliner Regierung würde europäisch koordiniert vorgehen. Statt den Engländern beim Konjunkturprogramm vor den Kopf zu stoßen, wie es unser Finanzminister getan hat, hätten wir unsere Nachbarn für uns einnehmen sollen. Statt dessen haben wir uns nationalistisch gebärdet. Ich hätte mir nach dem fulminanten internationalen Start unserer Bundeskanzlerin gedacht, daß sie auch im Krisenjahr 2008 und im Krisenjahr 2009 eine wirklich global orientierte Regierungschefin ist. Das ist sie leider nicht.«2
International, so lautet meine zweite These, bläst der deutschen »Stabilitätspolitik« gegenwärtig der Wind ins Gesicht. Nach der Krise 1974/75 hatte sie dagegen Rückenwind. Damals hatte sich ein stärker keynesianisch geprägtes internationales Regime erschöpft, und in Großbritannien und den USA begann sich in Stolperschritten aus der Krise der Neoliberalismus durchzusetzen. Heute steht das neoliberale Akkumulationsregime vor dem Bankrott. Daraus folgt nicht automatisch, daß sich ein internationaler New Deal durchsetzen wird. Es gibt jedoch eine starke Tendenz dafür in den USA. Und vor allem: Die historisch erprobten Alternativen, um aus der Krise wieder herauszukommen, sind für die herrschenden Klassen nicht sehr zahlreich.
Binnenmarkt an der kurzen Leine
Über die Wechsel in den Herrschaftsmethoden der Bourgeoisie hat Lenin geschrieben: »Nicht aus böser Absicht einzelner Personen und nicht zufällig geht die Bourgeoisie von der einen Methode zur anderen über, sondern infolge der radikalen Widersprüche ihrer eigenen Lage« (LW 16, S. 356). Man muß hinzufügen: Auch nicht infolge der guten Ideen eines charismatischen, neu gewählten US-Präsidenten erfolgt ein solcher Wechsel. Durch Obamas Wahl ist jedoch in den USA, dem Land mit dem größten Binnenmarkt, eine Richtungsentscheidung der Bevölkerung zugunsten eines Auswegs in der Tradition des New Deal gefallen, das heißt, eines eher keynesianisch geprägten Auswegs.Altbundeskanzler Helmut Schmidt ist sicher Realist, wenn er in der Zeit vom 15. Januar 2009 schreibt: »Tatsächlich ist damit zu rechnen, daß die Regierenden sich nur schrittweise an die Lösung der heutigen Probleme herantasten.« Auch der von Obama eingeschlagene Weg kann scheitern, in die »Mitte« gerückt oder wieder zurückgedreht werden, je nachdem, wie die inneren Kräfteverhältnisse sich weiterentwickeln. Doch er schafft zunächst für die Bourgeoisien der anderen Länder eine Situation, an die sie sich anpassen müssen.
Hocherfreut ist die Bundesregierung darüber nicht. Merkel hißt statt dessen die Fahne für eine »Globalisierung der sozialen Marktwirtschaft« und meint damit den bisherigen Kurs der Bundesregierung als Modell für alle. Ähnlich wie Schröders »Modell Deutschland« soll das wohl vor allem der eigenen Bevölkerung eine »Vision« vortäuschen.
Merkel propagiert fünf hehre Prinzipien der »globalen sozialen Marktwirtschaft«, darunter das Prinzip, daß das Finanzsystem »eine dienende Funktion« haben müsse. Dagegen weist Bundesbankchef Axel Weber im Handelsblatt vom 1. Februar die italienische Forderung nach einer gemeinsamen Euro-Anleihe mit der Begründung ab, daß eine solche Anleihe »die disziplinierende Wirkung der Finanzmärkte« auf verschuldete Länder mindern würde.
Das Monopolkapital der Bundesrepublik versucht, als Trittbrettfahrer von den weltweiten Konjunkturprogrammen zu profitieren und zugleich den heimischen Binnenmarkt weiter an der kurzen Leine zu halten. Den Jahresausblicken vieler Konzerne und Branchenverbände kann man entnehmen, wie Infrastruktur- und Baukonzerne, Baumaschinenhersteller, Windkraft- und Solarindustrie oder sogar die Gläubigerbanken eines verschuldeten Baustoffkonzerns auf Aufträge aus den Konjunkturprogrammen vor allem Chinas und der USA setzen.
Natürlich schmerzt es sie, wenn im Entwurf des US-Konjunkturprogramms eine »Buy American-Klausel« für den Einkauf von Stahl und Eisen zu finden ist. Es wird protestiert und mit Gegenmaßnahmen gedroht. Eine Eskalation protektionistischer Beschränkungen im Welthandel würde allerdings auf starke Gegenkräfte treffen. Die transnational agierenden Monopole aller Länder brauchen den Zugang zu ausländischen Märkten und wissen, daß dieser nur auf der Basis der Gegenseitigkeit (Reziprozität) zu haben ist. Das gilt nicht nur für die Großkonzerne Japans, der BRD, Indiens und Chinas. Auch US-Konzerne wie GE, Caterpillar, Microsoft, Exxon oder Ford, um nur wenige zu nennen, brauchen offene Märkte.
Die USA verfügen mit dem größten Binnenmarkt der Welt über ein Druckmittel, um andere Exportländer zu Zugeständnissen zu bewegen, die den USA die Restrukturierung ihrer heute nicht konkurrenzfähigen Industriezweige ermöglichen. Solche Rücksichtnahmen hat es im staatsmonopolistischen Kapitalismus öfter gegeben, man denke an die Stahlquoten. Es ist denkbar, daß die Obama-Regierung den Freihandel in diesem Sinne verwässern wird.
Dies würde den Druck auf exportabhängige Länder erhöhen, mehr für die eigenen Binnenmärkte und damit für die individuelle und gesellschaftliche Konsumtionskraft der eigenen Bevölkerung zu tun. China scheint dies mit seinem gigantischen Konjunktur- und Investitionsprogramm schneller begriffen zu haben als die BRD. Es gilt aber auch für die BRD und Europa, gerade auch für die verschuldeten Euroländer, die Axel Weber am liebsten den Folterwerkzeugen des IWF ausliefern würde.
Für Gewerkschaften, Sozialverbände und andere außerparlamentarische Bewegungen ergeben sich Chancen, die internationalen Widersprüche auszunutzen, um die Richtung des Auswegs aus der Krise auch bei uns stärker zugunsten der arbeitenden Bevölkerung zu beeinflussen. Hierfür zu wirken, ist meines Erachtens auch die vordringliche Aufgabe von Linken, Sozialisten und Kommunisten. Zwar wissen wir, und niemand hindert uns, es zu sagen, daß auch eine stärker keynesianisch geprägte Politik die Widersprüche des Kapitalismus letztlich nicht lösen kann. Ebenso klar ist aber, daß die Arbeiterklasse und die Volksmassen im Kampf um Reformen die Kraft und das Selbstbewußtsein erst noch erwerben müssen, die sie für eine sozialistische Umwälzung brauchen werden.
1 Heinz Jung/Josef Schleifstein: Die Theorie des staatsmonopolistischen Kapitalismus und ihre Kritiker, Frankfurt/Main 1979, S. 100 f. »SMK« ist ein Kürzel für »Staatsmonopolistischer Kapitalismus«
2 Results Newsletter Januar 2009 (Homepage von Norbert Walter)
Veröffentlicht in Junge Welt 2.3.2009

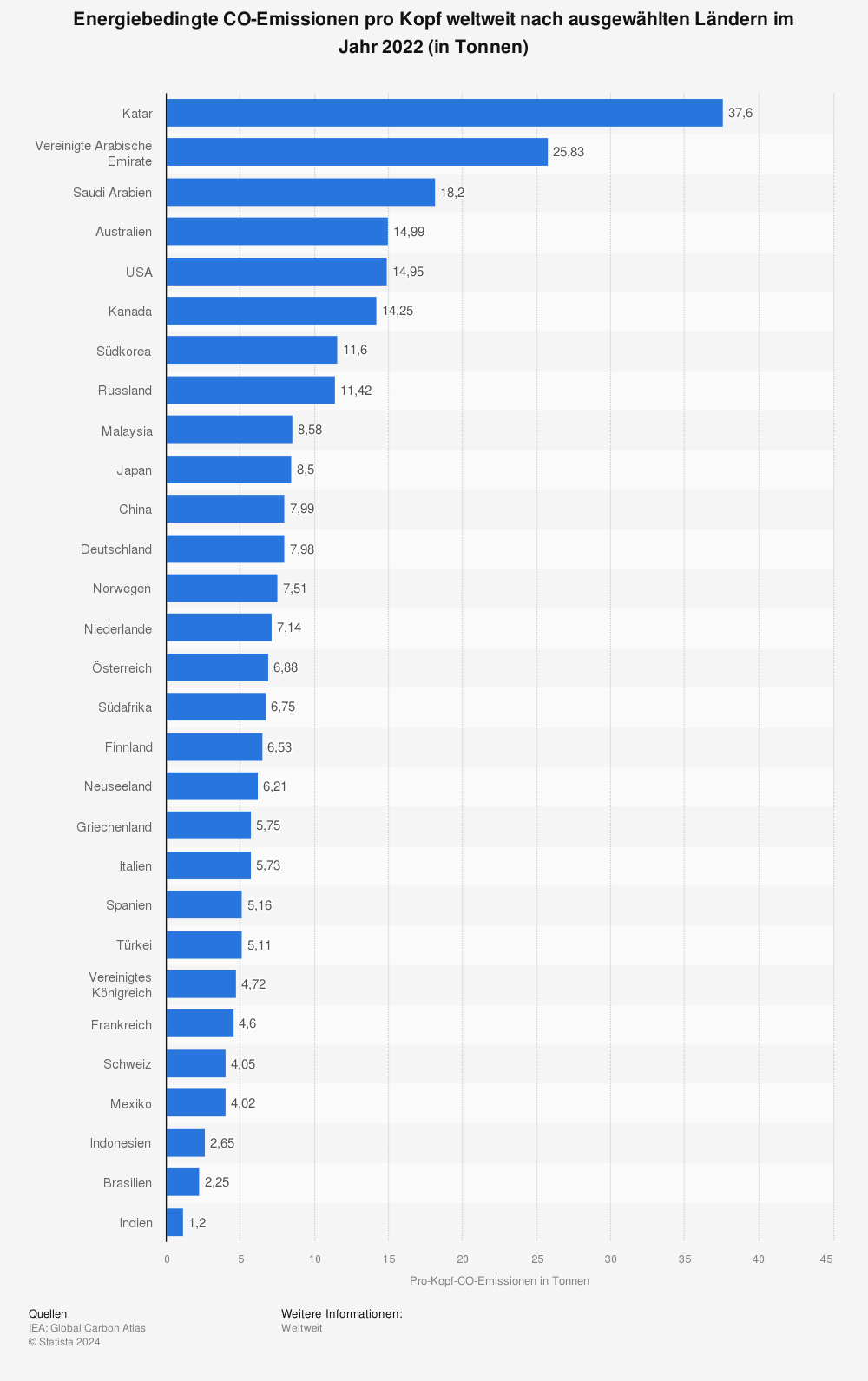





Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen